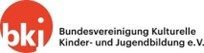Werkstattgespräch #2: Welt erkunden – Welt begreifen
Ästhetisches Forschen als Weg zu mehr Teilhabe
Ein Rückblick auf das Werkstattgespräch der Beratungsstellen „Kultur macht stark“ Brandenburg und Rheinland-Pfalz am 27. Mai 2025 von Tabea Herrmann
Wie erschließen sich Kinder die Welt? Durch Staunen, Ausprobieren, Experimentieren. Durch ästhetische Erfahrungen, die sie mit allen Sinnen machen. Durch ästhetisches Forschen. Das digitale Werkstattgespräch „Welt erkunden – Welt begreifen“ am 27. Mai 2025 rückte genau diese Prozesse in den Mittelpunkt und fragte: Wie können wir Kinder dabei unterstützen, forschend die Welt zu entdecken? Welche Rolle spielen Materialien, Räume, künstlerische Techniken? Und wie wird ästhetisches Forschen zu einem Weg der Teilhabe – gerade für Kinder in Risikolagen?
Was ist ästhetisches Forschen?
Ästhetische Erfahrungen sind der erste Zugang zur Welt. Sie sind Kern ganzheitlicher frühkindlicher Bildung und Grundlage Kultureller Bildung. Doch was bedeutet „ästhetisches Forschen“ konkret? Es geht um mehr als passive Kunstbetrachtung oder angeleitetes Basteln. Der Begriff unterscheidet sich grundlegend vom traditionellen Forschungsbegriff, der größtmögliche Objektivität und rationale Nachvollziehbarkeit fordert. Ästhetisches Forschen hingegen bezieht subjektive Erfahrungen als Wissen in Betrachtungen und Erkenntnisgewinn ein. Gefühle, sinnliche Wahrnehmungsweisen und Assoziationen sind Teil der Forschung. Ziel ist es, einen Raum zu kreieren, in dem eigensinnige Fragestellungen entwickelt und verfolgt werden können. Gestaltung wird dabei nicht nur als Produkt verstanden, sondern als Form der Reflexion.
Fachimpuls: Drei Wege zum Verstehen

Katja Fillmann, Dozentin für ästhetische Bildung am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg, zeigte im Fachimpuls die Besonderheit des ästhetischen Forschens. Ihre zentrale Botschaft: Ästhetisches Forschen verbindet drei Bezugsgrößen – Alltag, Kunst und Wissenschaft. Diese Verknüpfungen eröffnen einen vernetzten Prozess mit verschiedenen Wissensformen. Der Akt der Wahrnehmung wird dabei zum Akt des Denkens.
Lernprozesse in der frühen Kindheit besitzen genau diesen Charakter ästhetischer Bildung. Die Künste in ihrer Vielfalt – von Musik über Tanz und Theater bis hin zu bildnerischen Kunstformen, digitalen Medien und Erzählkunst – halten für junge Kinder wertvolle Anregungsimpulse bereit.
Darum passt das Konzept des ästhetisches Forschen in die frühkindliche Bildung
Fillmann zeigte die vielfältigen Analogien auf. Kinder haben eine ästhetisch-leibsinnliche Zugangsweise zur Welt – sie begreifen buchstäblich, mit allen Sinnen, mit dem ganzen Körper. Sie lernen durch starke Prozessorientierung und Handlungslernen, im Tun, im Ausprobieren, im Experimentieren. Ihre Bildungsbewegung ist transdisziplinär – sie trennen nicht zwischen Kunst, Mathematik, Sprache, sondern verbinden alles in ihrem Spiel. Der Umgang von Kindern mit Dingen entspricht oft künstlerischen Praktiken. Sie haben eine natürliche Offenheit für Unbekanntes – sie haben noch nicht gelernt, dass manche Fragen „dumm“ oder manche Wege „falsch“ sind. Diese Korrespondenz zwischen ästhetischem Forschen und kindlichem Bildungshandeln macht das Konzept so wertvoll für die frühkindliche Bildung.
Ästhetisches Forschen in der Praxis
Im Zentrum steht die Prozessorientierung: Die Suchbewegungen der Kinder werden ernst genommen und mit künstlerischen Praktiken verbunden. Wissensformen aus den Gebieten Alltag, Kunst und Wissenschaften werden dabei unhierarchisch kontextualisiert. Das Wissen, das ein Kind aus seinem Alltag mitbringt, ist genauso wertvoll wie künstlerische oder wissenschaftliche Perspektiven.
Ästhetische Erfahrungen eröffnen Fragen, Suchbewegungen und Erkenntnisse. Es wird eine Arbeitshaltung forciert, die von Neugierde und Staunen geprägt ist. Spielen wird als explorativer Raum begriffen, in dem erforscht, ausprobiert, verworfen und neu begonnen wird. Das Klären geschieht im Handeln – exploratives Handeln und Gestalten fungieren als Reflexion. Kinder denken mit ihren Händen.
Besonders wichtig ist der Raum und die Anerkennung für Erkenntnisweisen, die im Vorbegrifflichen liegen, in den symbolischen Ausdrucksweisen von Kindern. Nicht alles muss in Worte gefasst werden können.
Spurensucher:innen sein: Die Rolle der Erwachsenen
Eine zentrale Botschaft Fillmanns war: „Unsere Rolle ist es, Spurensucher:innen zu sein!“ Erwachsene in ästhetischen Forschungsprozessen bewegen sich zwischen eigenem Verwickeltsein und notwendiger Distanz. Künstler:innen und Pädagog:innen arbeiten eng zusammen, bereiten vor und nach, reflektieren gemeinsam.
Ihre Aufgabe ist es, Settings zu entwickeln, in denen performative, spielerische Suchbewegungen stattfinden können, in denen die Fragen der Kinder bearbeitet werden können, beziehungsweise in denen neue Fragen entstehen können. Diese Haltung braucht keine aufwendigen Materialien oder teuren Ausstattungen. Sie braucht vor allem Zeit, Raum und die Bereitschaft, Kinder in ihren Forschungsprozessen zu begleiten, ohne sie zu sehr zu lenken.
Aus der Praxis: Kita-Kunst-Kreisel Bad Kreuznach
Das Projekt „Kita-Kunst-Kreisel“ aus Rheinland-Pfalz, gefördert durch „Künste öffnen Welten“, dem Förderkonzept der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) bei „Kultur macht stark“, zeigt exemplarisch, wie ästhetisches Forschen praktisch umgesetzt werden kann. Renate Ziegler, Initiatorin und Leiterin der Kunstwerkstatt Bad Kreuznach, berichtete im Werkstatt-Gespräch von ihren Erfahrungen.
Im „Kita-Kunst-Kreisel“ wird kulturelle Bildung zum selbstverständlichen Teil des Kita-Alltags. Kinder haben hier die Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Materialien zu experimentieren – von klassischen Farben und Ton bis zu Naturmaterialien und Alltagsgegenständen. Sie erforschen Formen, Strukturen, Farben. Sie probieren aus, wie verschiedene Materialien sich anfühlen, wie sie sich kombinieren lassen, welche Wirkungen entstehen.
Die Erfahrung zeigt: Ästhetische Bildung ist keine Frage großer Budgets, sondern kreativer Konzepte und engagierter Menschen.
Teilhabe durch ästhetische Erfahrung
Ästhetisches Forschen ist weit mehr als ein pädagogisches Konzept – es ist ein Weg zur Teilhabe. Wenn Kinder lernen, ihre Umwelt aktiv zu gestalten, ihre Wahrnehmungen auszudrücken und gemeinsam mit anderen kreative Lösungen zu finden, entwickeln sie jene Kompetenzen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in einer demokratischen Gesellschaft benötigen.
Gerade für Kinder in Risikolagen können solche Erfahrungen transformativ wirken. Kinder, die im schulischen Kontext vielleicht wenig Erfolgserlebnisse haben, können im ästhetischen Forschen ihre Stärken entdecken. Kinder mit Sprachbarrieren können sich über künstlerische Ausdrucksformen mitteilen. Kinder, die sonst wenig Selbstwirksamkeit erleben, erfahren hier: Ich kann etwas gestalten. Ich kann etwas bewirken.
Gemeinsam Welten öffnen
Für die Teilnehmenden war klar: Es lohnt, in ästhetische Bildung zu investieren – für die Kinder und für die Gesellschaft. Denn wenn Kinder die Welt forschend erkunden, begreifen sie nicht nur die Welt – sie lernen auch, sie aktiv mitzugestalten.
Das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und läuft in der aktuellen Förderphase bis 2027.
Kontakt
Tabea Herrmann
Beratungsstelle „Kultur macht stark“ Brandenburg
Tabea Herrmann
kumasta@gesellschaft-kultur-geschichte.de
Telefon +49 331 58 250 120
www.kulturmachtstark-brandenburg.de