Werkstattgespräch #4: Alle spielen mit!
Warum das Recht auf Spiel ein Recht auf Teilhabe ist
Ein Rückblick auf das Werkstattgespräch der Beratungsstellen „Kultur macht stark“ Brandenburg und Rheinland-Pfalz vom Werkstattgespräch am 10. Oktober 2025
Spielen ist Lernen. Spielen ist Forschen. Spielen ist Teilhabe. Das digitale Werkstattgespräch „Alle spielen mit!“ am 10. Oktober 2025 stellte eine fundamentale, aber oft übersehene Wahrheit in den Mittelpunkt: Das Recht auf Spiel ist untrennbar verbunden mit dem Recht auf Bildung, auf Teilhabe, auf ein gutes Aufwachsen.
Die Beratungsstellen „Kultur macht stark“ Brandenburg und Rheinland-Pfalz versammelten Expert:innen aus Praxis und Forschung, um gemeinsam mit Kita- und Schul-Trägern, Fördervereinen und Akteuren der Kulturellen Bildung zu erkunden, wie spielorientierte Ansätze konkret umgesetzt werden können und warum Spiel als fundamentales Kinderrecht ernst genommen werden muss.
Spielen ist ein Kinderrecht
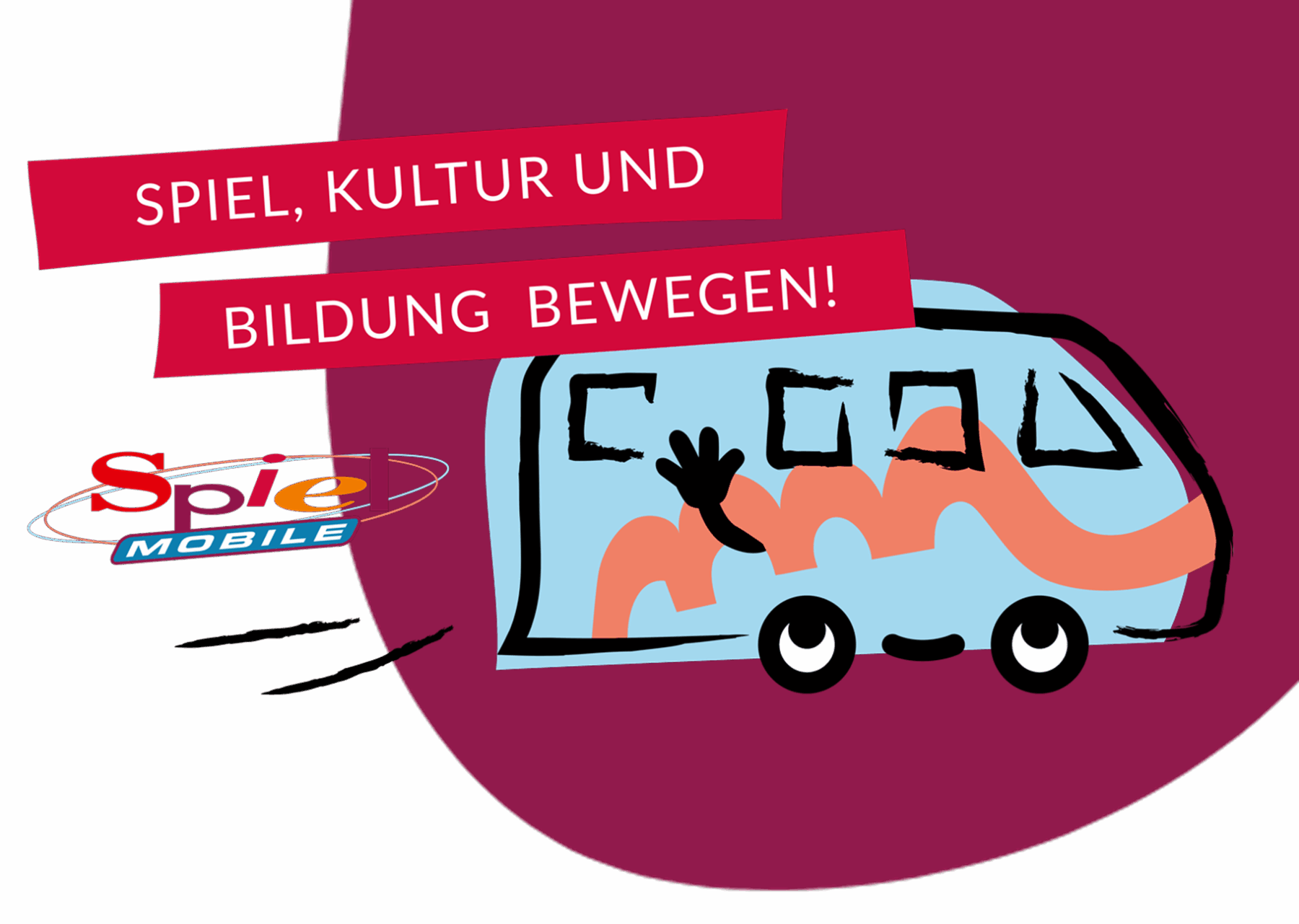
Die UN hat 1989 das Recht des Kindes auf Spiel als eine fundamentale Aktivität und ein grundlegendes Recht für die gesunde Entwicklung des Menschen in die Kinderrechtskonvention aufgenommen. Artikel 31 erkennt ausdrücklich das Recht des Kindes auf Ruhe, Freizeit, Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben an.
Doch was bedeutet das konkret? Das Spiel ist die älteste Lernmethode der Menschheit und anthropologische Grundlage aller kulturellen Tätigkeiten. Spiel ist kein Luxus, keine Belohnung, die Kinder sich erst „verdienen“ müssen – Spiel ist Bildung. Das Werkstattgespräch machte deutlich: Diese Rechte müssen im Alltag von Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen konkret umgesetzt werden.
Was ist freies Spiel?
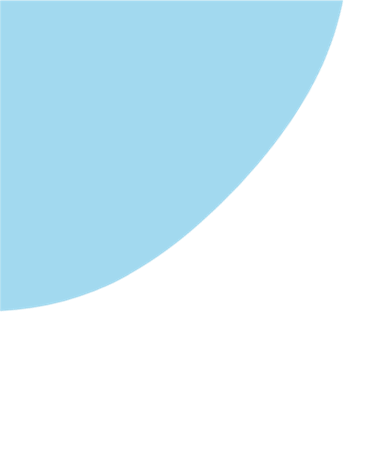
Carla Bergen von Spielmobile e.V. gab wichtige Impulse aus der Spielpädagogik und erläuterte die Merkmale von freiem Spiel. Echtes Spiel zeichnet sich durch fünf zentrale Charakteristika aus:
- Es ist freiwillig und spontan
- Es ist zweckfrei und um seiner selbst willen geschehend
- Es findet in einer spielerischen Scheinwelt statt, die flexible und fantasievolle Anpassung der Realität ermöglicht
- Spiel ist positiv aktivierend in einem stressfreien Umfeld
- Es ist geprägt von Wiederholungen und Ritualen
Diese Definition macht deutlich: Nicht alles, was wir „Spiel“ nennen, ist wirklich Spiel im pädagogischen Sinne. Angeleitete Aktivitäten mit vorgegebenem Ziel mögen wertvoll sein, ersetzen aber nicht das freie Spiel.
Spielen ist für Kinder ein Zugang zur Welt
Spiel ist „so tun als ob“. Im Spiel wird eine eigene Wirklichkeit in den Gedanken und Handlungen der Spielenden konstruiert. Diese scheinbar simple Definition birgt enorme Bildungspotenziale.
Im Spiel können Kinder:
- Identitäten erproben und wechseln
- Machtverhältnisse umkehren und neu gestalten
- Konflikte durchspielen und Lösungen finden
- Ängste bearbeiten und Mut entwickeln
- Regeln verstehen, verhandeln und verändern
Jürgen Fritz unterscheidet elf Reizquellen des Spiels: Wettkampf, Wagnis, vom Zufall bestimmt werden, Spaß und Überraschung, Rausch, Entspannung, Sammelleidenschaft, sich in andere verwandeln, ästhetischer Genuss, künstlerische Gestaltung und Problemlösung. Diese Vielfalt zeigt: Spiel spricht unterschiedliche Bedürfnisse an und erreicht verschiedene Kinder auf verschiedenen Wegen.
Fünf Wirkungsfelder von Spiel
Bergen stellte die zentralen Wirkungsfelder vor:
Physisch: Aus der Hirnforschung weiß man, dass völlig absichtsloses Spielen für die besten Vernetzungen im Gehirn sorgt. Spielen ist Dünger für das Gehirn und Kraftfutter für Kinderseelen, wie Gerald Hüther und Christoph Quarch es formulieren.
Psychisch: Spiel stärkt das Selbstvertrauen, fördert die Ausbildung von Resilienz und ermöglicht die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Eine alarmierende Erkenntnis: Mit Abnahme des Spielens steigt die Häufigkeit von Depressionen bei Kindern. Das Gegenteil von Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression.
Kognitiv: Spiel ist Ausgangspunkt von Subjektivität und Begeisterung und damit elementare Voraussetzung für jegliches Lernen. Wenn das Kind in einem künstlerischen Prozess produktiv tätig wird, richtet es seine Aufmerksamkeit auf eine innere Vorstellung, für die es dann eine äußere Form findet. Dieser kreative Prozess braucht Zeit, Raum und Freiheit.
Soziale Kompetenzen: Kinder lernen durch Spiel die Folgen ihrer Handlungen für andere kennen, entwickeln Einfühlungsvermögen, Verständnis für andere und Gemeinschaftsgefühl. In Konfliktsituationen lernen sie, den eigenen Standpunkt einzubringen und Kompromisse zu finden.
Gesellschaftlich: Lernpsychologen nennen Spielen selbstorganisiertes, intrinsisch gesteuertes Lernen. Eine Welt, in der sich das Wissen alle 2,5 Jahre verdoppelt, braucht kritische Denker und kreative Erneuerer. Wir brauchen Kinder, die aus Fehlern lernen und die Ausdauer haben, Neues zu erschaffen. Spielen bringt all das mit.
Spiel und Chancengerechtigkeit
Gerade für Kinder in Risikolagen ist Spiel besonders bedeutsam: Sie können im Spiel zugleich Teil einer Gemeinschaft sein und ihre eigene Identität entwickeln. Das Werkstattgespräch thematisierte auch eine schwierige Realität: Viele kulturelle Angebote wirken exklusiv statt inklusiv. Schülerinnen und Schüler in benachteiligten Lebenslagen haben bis heute auch in der Kulturellen Bildung deutlich weniger Zugang zu Angeboten als Kinder der Mittelschicht.
Spielorientierte Ansätze haben das Potenzial, diese Barrieren zu überwinden – wenn sie niedrigschwellig, kostenlos und offen für alle gestaltet sind.
Aus der Praxis: "Spielen macht stark!"
Christina Nefzger stellte das Förderprogramm „Spielen macht stark! – Erforschen, Gestalten und Aneignen“ vor. Das Programm von Spielmobile e.V. im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert bundesweit lokale Bündnisse, die außerschulische Angebote der kulturellen Bildung initiieren und umsetzen.
Die Vielfalt des Spiels steht als Inhalt und Methode im Fokus, verbunden mit vier Schwerpunktthemen – kreative Vielfalt, Digitalität, Nachhaltigkeit und Demokratie. Vier Formate stehen zur Auswahl:
- Kreative Spielräume: Die Teilnehmer:innen arbeiten kreativ zusammen, erstellen zum Beispiel eine Schnitzeljagd oder gestalten ihre Wohnumgebung künstlerisch um.
- Nachhaltige Spielräume: Die Teilnehmer:innen erkunden die Natur, entwickeln digitale Nachhaltigkeits-Touren oder planen Upcycling-Aktionen.
- Digitale Spielräume: Die Teilnehmer:innen gewinnen digital eine neue Perspektive auf ihren Sozialraum und produzieren Audiowalks, Videodokumentationen oder nutzen Virtual Reality.
- Demokratische Spielräume: Hier erkunden die Teilnehmer:innen, was sie in ihrem Sozialraum ändern wollen, und machen ihre Ideen sichtbar.
Besonders die Schwerpunktthemen Kreative und Nachhaltige Spielräume empfiehlt sie für die Arbeit mit kleinen Kindern im Kontext Kita und betont, dass sie sehr gerne für Interessenten aus Brandenburg ansprechbar ist, da hier ein großes Förderinteresse besonders in den ländlichen Räumen Brandenburgs besteht.
Maria Meiners-Gefken von der VHS Krempe e.V. berichtete aus der konkreten Projektarbeit. Ihre Erfahrungen zeigen: Wenn Kinder und Jugendliche ihre Umgebung selbstständig erforschen, gestalten und sich aneignen können, entstehen transformative Bildungserlebnisse.
Spielen ist Zukunft
Das Werkstattgespräch „Alle spielen mit!“ bot intensive Praxiseinblicke, lebhaften Austausch und konkrete Impulse. Die Abschlussfrage von Carla Bergen hallte nach: Wie würde eine Welt ohne freies Spiel aussehen? Die Antwort liegt in den Wirkungsfeldern, die das Werkstattgespräch aufgezeigt hat: Es wäre eine Welt mit weniger Kreativität, weniger Resilienz, weniger sozialen Kompetenzen. Eine Welt, die wir nicht wollen.
Jedes Kind, das spielt, gestaltet ein Stück Zukunft – seine eigene und die der Gesellschaft. Es lohnt sich, Räume für Spiel zu schaffen, Ressourcen bereitzustellen, Barrieren abzubauen. Das Kinderrecht auf Spiel zu verwirklichen bedeutet, das Grundrecht auf Teilhabe, Bildung und ein gutes Leben ernst zu nehmen.
Das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und läuft in der aktuellen Förderphase bis 2027.
Kontakt
Tabea Herrmann
Beratungsstelle „Kultur macht stark“ Brandenburg
Tabea Herrmann
kumasta@gesellschaft-kultur-geschichte.de
Telefon +49 331 58 250 120
www.kulturmachtstark-brandenburg.de










